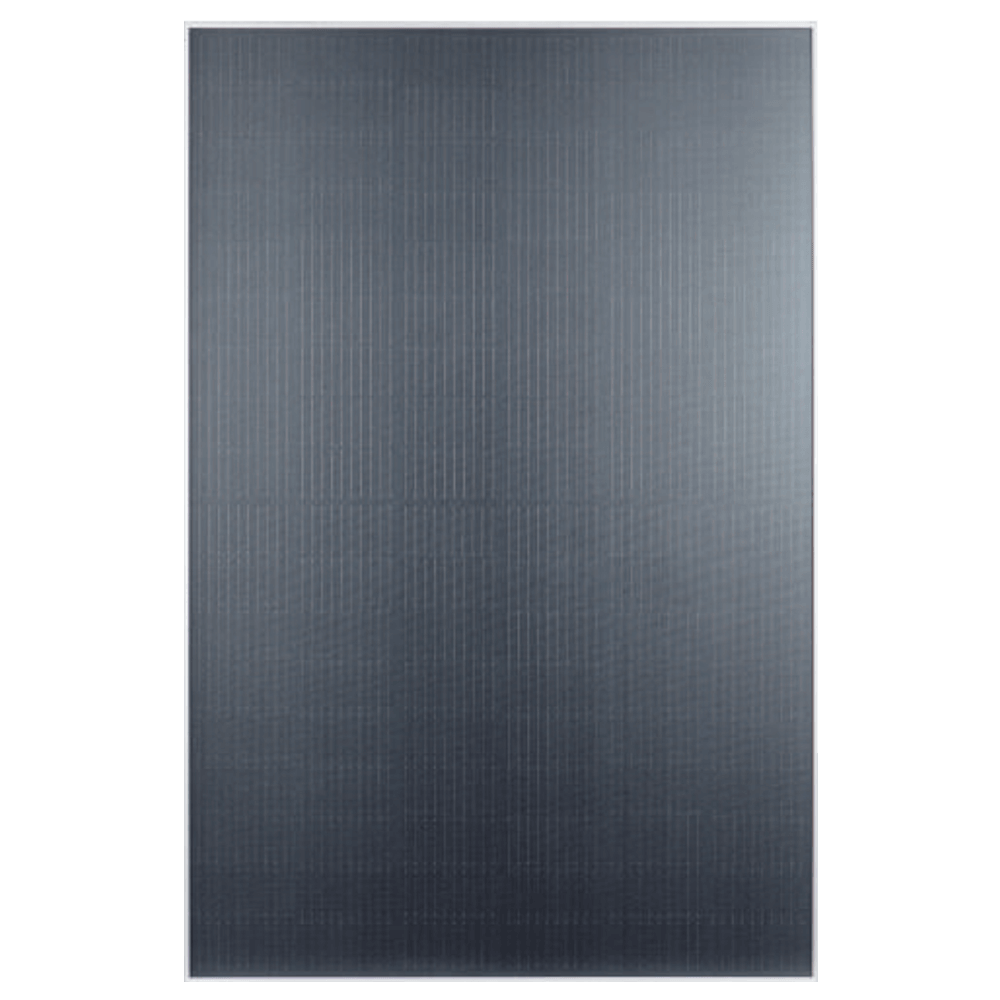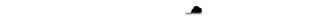Wenn Carl Leo auf die Häuserzeilen blickt, denkt er zuerst an Potenzial. „Man muss auf fast jedem Dach Solarenergie haben“, sagte er. Doch auch der Physikprofessor an der Technischen Universität Dresden weiß, wie schwer es ist.
Das Dach hat eine Krümmung oder einen Winkel und die Fenster können nicht verdeckt werden. „Dadurch wird viel wertvoller Raum unbrauchbar“, erklärt Leo, einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Solarzellentechnologie.
Aufgrund der geplanten Umstellung auf Ökostrom bis 2035 werden die Regeln für die Installation von Solaranlagen in Neubauten in allen deutschen Bundesländern unterschiedlich verschärft. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz sieht vor, dass die in Deutschland bis zum Jahr 2030 installierte Gesamtleistung an Photovoltaik-Anlagen im Jahr 2030 erreicht werden soll 215 Gigawatt erreichen. Daher muss laut PV-Strategieplan des Bundeswirtschaftsministeriums die neue PV-Leistung von satten 7 Gigawatt im Jahr 2022 auf 22 Gigawatt pro Jahr verdreifacht werden.
Um diese Ziele zu erreichen, ist mehr Platz erforderlich. Wissenschaftler haben eine neue Art von Solarmodulen entwickelt, die eine Lösung dieses Problems verspricht: organische Solarzellen. Dünne, biegsame organische Solarzellen bestehen nicht aus Silizium, sondern aus Kohlenwasserstoffen. Die Möglichkeiten sind endlos.
Die statischen Eigenschaften gebogener Dächer, Karosserien und Flugzeugflügel sind für den Einbau herkömmlicher Siliziumbauteile noch nicht geeignet. Die neuen flexiblen Solarzellen können nicht nur an diesen Orten eingesetzt werden, sondern sogar auf Glasfassaden und Fenstern installiert werden, da sie nur einen Teil des sichtbaren Lichts absorbieren.
Die niedrige Umwandlungsrate ist der Hauptgrund dafür, dass organische Solarzellen mit vielen Vorteilen nicht weit verbreitet sind. Herkömmliche Siliziummodule können 20 % der Sonnenenergie in Strom umwandeln, während organische Solarzellen eine Umwandlungsrate von nur 9 % haben.
Die Region kann Solarzellen zu geringeren Kosten produzieren und verfügt außerdem über große Mengen seltener Erden, die für die Herstellung herkömmlicher Solarzellen benötigt werden. Organische Solarzellen benötigen solche Rohstoffe nicht. Diese neue Art der Energiegewinnung soll einen Teil der Solarindustrie nach Deutschland zurückholen.
„Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir entweder die Produktionskosten senken oder über Patente und Technologie verfügen“, sagt Herr Leow. Organische Batterien könnten die Antwort sein. „Wir verfügen über das Wissen und praktische Basispatente in den Bereichen Materialien, Komponenten und Fertigungstechnologie“, fügte er hinzu.
Leau forderte mehr Forschungsgelder, um die Entwicklung Deutschlands auf diesem Gebiet zu beschleunigen. „Wir könnten viel mehr tun, wenn Forschungsprojekte besser unterstützt würden“, sagt er.
Leo beschäftigt sich seit den 1990er Jahren an der Technischen Universität Dresden mit organischen Solarzellen. Neben ihm betreiben auch etwa 30 Unternehmen und Dutzende Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt relevante Forschung. 2006 gründete der Physiker gemeinsam mit fünf weiteren Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden und der Universität Ulm Heliatek. Das Unternehmen produziert seit 2019 organische Solarzellen in Massenproduktion und ist in diesem Bereich Weltmarktführer.
Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen den deutschen E.ON Energy-Konzern, den südkoreanischen Technologieriesen Samsung sowie Unternehmen aus Frankreich, Spanien, Großbritannien, Singapur und Japan. Guido Van Tatvek, Direktor von Helia Technologies, sagt, dass die Nachfrage aus Südostasien besonders stark wächst.
 English
English Español
Español Deutsch
Deutsch عربى
عربى